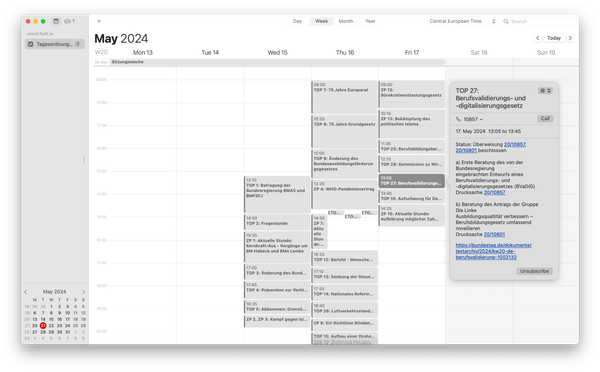Warum Fuji-Filmsimulationen das Zeug haben, die Photographie im Zeitalter ihrer digital optimierten Beliebigkeit zu retten
Fujis Filmsimulationen sind keineswegs Nostalgie, sondern der radikale Gegenentwurf zu einer zunehmenden Verlagerung des Schaffensprozesses in die Postproduktion.

Einer der Gründe, aus denen ich mich letzten Herbst für den Kauf einer Fujifilm-Kamera entschieden habe, waren die schönen JPEGs, die Fujis X-Trans-Sensoren erzeugen. In Kombination mit den sogenannten Filmsimulationen, einer weiteren Fuji-Eigenheit, bei der die Charakteristika analoger Negativ- und Diafilme simuliert werden, fällt so die Notwendigkeit weg, seine Schnappschüsse nachträglich nachzubearbeiten, bis man mit den Farbtönen, Gradationskurven oder der Sättigung zufrieden ist. Obwohl diese Funktion auf den ersten Blick eher nach einem anachronistischen Gimmick klingt, existiert mittlerweile eine große Community, die ihre Kameraeinstellungen zur Simulation analoger Filme (als sogenannte Rezepte bzw. Recipes) teilt. Eine der vielleicht bekanntesten Websites, auf der diese Rezepte zusammengetragen werden, ist Fuji X Weekly.
Ich muss sagen, ich bin verliebt in die Farben vieler dieser Rezepte. Denn im Gegensatz zu den Farbprofilen anderer Kamerahersteller, ändern sich Farbtöne nicht linear mit der Helligkeit, sondern reagieren – wie analoge Filme – bei Unterbelichtung anders als bei Überbelichtung. Auch die Color-Chrome-Effekte, die die Luminanz der Blau-, Gelb-, Grün-, Rot- und Orangetöne verringern und diese dadurch gesättigter wirken lassen, sehen keinesfalls aus wie trashige Instagram-Filter, sondern erinnern tatsächlich an das Verhalten von Diafilmen wie Kodachrome. Seit dem ersten Tag, an dem ich meine Fujifilm X-T4 ausgepackt habe, experimentiere ich nun mit diesen Rezepten. Sie und das klassische Design der X-T4 mit ihren physischen Einstellrädchen für ISO und Belichtung als auch den dazu passenden Fujinon-Optiken, die fast alle einen manuellen Blendenring besitzen, sind der Grund, weshalb ich meine Kamera mittlerweile wie eine analoge Spiegelreflexkamera nutze. So banal es klingt: Das Display klappe ich beim Photographieren so ein, dass es nach innen zeigt; es fehlt eigentlich nur noch die Klappe zum Einlegen des Films, um sich selbst Glauben zu machen, es handle sich tatsächlich um eine Rollfilmkamera. Und nach über einem halben Jahr kann ich sagen, dass mir das die Freude an der Photographie zurückgegeben hat.
Zugegeben, es klingt erst einmal paradox, eine digitale Kamera so nutzen zu wollen, als sei sie analog. Schließlich ist der Spielraum, den RAW-Dateien bei der Nachbearbeitung bieten, ein Riesenvorteil. Ganz zu schweigen davon, dass man bei sich bewegenden Motiven im Serienbildmodus seinen Finger im Grunde auf dem Auslöser liegen lassen kann und garantiert eine Aufnahme dabei sein wird, mit der man zufrieden ist – ganz im Gegensatz zu einer Rolle Film, deren Platz für Aufnahmen sehr begrenzt ist. Versteht mich nicht falsch: All diese Möglichkeiten möchte ich auch nicht missen, vor allem nicht in professionellen Kontexten. Trotzdem glaube ich, dass sie niemanden zu einer besseren Photograph_in machen.
Als ehemaliger Sony α6400-Shooter war meine Kamera praktisch immer im Serienbildmodus. Löschen kann man die vielen Schnappschüsse in Bridge ja noch immer, bevor man in Lightroom die Haut- und Grüntöne korrigiert und ein Preset drüberklatscht. Egal, was mir vor die Linse sprang, ich hielt im Blendenprioritäts-Modus erst einmal drauf; wenn ich meine Kamera dann noch etwas bewegte, hatte ich später die Wahl zwischen leicht verschiedenen Blickwinkeln. Den Großteil meiner Gedanken zur Bildkomposition sparte ich mir so fürs Aussortieren und Zurechtschneiden in der Postproduktion auf, wie auch Anpassungen bei der Belichtung. Eine Belichtungszeit um 1/250s bei einem Standardzoom-Objektiv ist ja in den wenigsten Situationen verkehrt. Klar wusste ich auch damals schon um die Limitationen einer solchen Bedienung; ich habe mich aber mehr »im Moment« gefühlt, wenn mir die Halbautomatik beim schnellen Knipsen ein paar Entscheidungen abgenommen hat.
Grundsätzlich ist an einem solchen Workflow auch nichts auszusetzen, doch mit dieser Art zu Photographieren blieben für mich drei wichtige Dinge auf der Strecke: Erstens der Raum und Spaß zum/beim Experimentieren. Beispielsweise wie mein Motiv aussähe, wenn ich eine längere Belichtungszeit nutze und Bewegungsunschärfe zeige. Oder was wäre, wenn ich die Blende mal weiter schlösse, um zwei eigentlich etwas voneinander entfernte Objekte in Bezug zueinander zu setzen.
Zum Zweiten die Fähigkeit, sich – noch bevor man den Sucher zum Auge führt – Gedanken um die Komposition zu machen: Welchen Bildausschnitt möchte ich zeigen? Wie komprimiert soll der Hintergrund sein und welche Brennweite muss ich dafür wählen? Wohin muss ich mich bewegen, um das Bild, das ich vor meinem inneren Auge sehe, in der richtigen Perspektive auf den Sensor zu bekommen?
Drittens und letztens habe ich auch weniger darüber nachgedacht, was ich warum photographieren möchte und welche Details mir dabei wichtig sind. Denn wenn man alles, was irgendwie spannend aussieht, schnell mal knipst, wird man am Ende keinem Motiv wirklich gerecht. Dabei ist die Inszenierung des Motivs, das Nachdenken darüber, was man aus welchem Grund für bedeutsam hält und was man weglässt, für welches Detail man belichtet und was im Schatten liegen soll, ja eigentlich das, was einen als Photograph_in zu mehr macht, als nur einer Person, die den Auslöser betätigt.
Natürlich braucht es keine Kamera von Fujifilm, um sich solche Fragen zu stellen und sich als Photograph_in weiterzuentwickeln. Dennoch halte ich die Philosophie, die hinter den Filmsimulationen steckt, für eine große Bereicherung für die zeitgenössische Photographie. Denn gerade jetzt, im angebrochenen Zeitalter von Computational Photography, in dem Künstliche Intelligenz das Bild teilweise bereits während der Verarbeitung des Sensorsignals optimiert und manipuliert, droht die Photograph_in zur bloßen Anwender_in degradiert zu werden, die im Grunde nur noch einen Knopf zu drücken braucht. Die Entscheidung darüber, welchem Detail beispielsweise durch die Belichtung oder dem Schärfebereich Wichtigkeit beigemessen wird und welchem nicht, nehmen einem die Kameras moderner Smartphones, aber auch Software wie Luminar AI bereits jetzt schon Schritt für Schritt aus der Hand. Selbst für professionelle Photograph_innen verlagert sich so ein immer größerer Teil des Schaffensprozesses in die Postproduktion, wo man dann mit einer Vielzahl von Schiebereglern versuchen kann, das Bild, das man beim Photographieren noch vor Augen hatte, nachzubilden. Der eigentliche Prozess des Photographierens, des Sich-Gedanken-machens bevor man den Auslöser betätigt, wird dabei immer beiläufiger.
Lässt man sich auf den Ansatz von Fujifilm ein und benutzt seine Kamera insofern »analog«, als dass man den Schaffensprozess in die Gegenwart verlagert und sich die notwendige Zeit zum Drehen der Einstellrädchen und Ausprobieren verschiedener Perspektiven nimmt, stehen am Ende nicht nur schöne JPEGs, sondern auch ein ganz anderer Bezug zum eigenen Werk. Ich kann hier wieder nur für mich sprechen, aber für mich verleihen Filmkorn, durch die Belichtung leicht ausgeblichene oder stärker verchromte Farben einem Bild einen Charakter und eine Plastizität, die ich bei den aalglatten, nachgeschärften und/oder rauschreduzierten Bildern mit den immergleichen Teal/Orange- oder Goldton-Lightroom-Presets, mit denen Social Media geflutet wird, vergeblich suche. Die allgegenwärtige technische Makellosigkeit gut retouchierter und optimierter Bilder langweilt mich. Sie löst einen Moment der Entfremdung in mir aus, in dem ich mich frage, ab wann eine solche Photographie das Einmalige, als das Walter Benjamin den festgehaltenen Moment fassen würde, überhaupt noch reproduziert; ab wann sie der Masse und Massentauglichkeit halber jeglichen Bezug zu ihrem Subjekt verloren hat.
Filmsimulationen sind im Zeitalter der Digitalphotographie keineswegs bloße Nostalgie. Im Gegenteil: Sie bieten Photograph_innen einen verloren geglaubten Bezug zum eigentlichen Schaffensprozess und dadurch auch zum festgehaltenen Moment. Sie sind der radikale Gegenentwurf zu einer anwachsenden Flut an digital optimierten und dabei doch lieblos aufgenommenen Bildern.